Die Magnetkraft von Geschichten
Warum das Schreiben von Geschichten das Leben zum Guten verändern kann: Erfahrungswerte aus der narrativen Therapie
- Barbara Pachl-Eberhart

In diesem Artikel erzähle ich Dir von einer Therapierichtung, die mich begeistert und die meine Arbeit als Schreibcoach noch sinnvoller macht als ich bisher schon dachte. Viel Freude beim Lesen!
💛
Ich bin Feuer und Flamme.
Kennst Du dieses Gefühl?
Na klar kennst Du es.
Begeisterung ist etwas, das wohl jeden Menschen ab und zu packt – sofern er sich nicht von Skepsis oder Resignation knebeln lässt.
Ich bin neugierig: Wofür hast Du in letzter Zeit gebrannt? Was hat Deine Begeisterung geweckt, was hat Dich entzündet, wovon konntest Du gar nicht genug bekommen?
Wenn ich an mich und meine letzten paar Monate denke, fallen mir gleich ein paar Dinge ein.
Spanisch, zum Beispiel – seit Anfang November. Unser Neujahrs-Wochenendtrip nach Barcelona war gerade gebucht, da habe ich mir schon die Vokabel-App heruntergeladen und zu pauken begonnen. Dann, in Barcelona, haben mein Mann und ich den ganzen Tag spanisch gebrabbelt, als könnten wir es tatsächlich. Und am Heimflug haben wir schon einen Roman auf spanisch gelesen (na gut, nur elf Seiten in zweieinhalb Stunden, mit dem PONS in der Hand, aber immerhin).
HIIT – High Intensity Interval Training. Auch so eine Sache, für die ich neuerdings brenne. Die Handy-App „Seven“ zwingt mich auf freundliche Weise dazu, täglich sieben Minuten (heftiges) Workout zu machen. Klingt wenig, bringt aber viel. Ok, um genau zu sein: brachte. Nämlich leider nicht nur Muskeln und Kondi, sondern auch akute Meniskusprobleme. Feuer und Flamme sind kurz mal gedämpft.
Wofür begeistere ich mich noch? Ja, genau: ganz aktuell für die Idee, meinen Wohnzimmerschrank durch ein Klavier zu ersetzen. Gar nicht so leicht, denn der Schrank ist sehr voll mit jener Art „Dies und das“, die sich im Laufe vieler Jahre ansammelt und großteils unnütz, aber doch unheimlich wichtig ist: alte Tagebücher, Kalender. Knäuel von Kabeln, die zu irgendwelchen Geräten gehören. Schachteln mit Bastelsachen, Aquarellfarben und Origami-Papier. Mein uralter Zirkel, zwei Geodreiecke, UHU-Patafix … Du weißt schon. Diese Art Schrank. Zwei Meter hoch, zwei Meter breit. Ich bin dabei, die Dinge zu ordnen und anderswo zu verstauen. Und wann immer ich ein Klavier sehe, seufze ich inzwischen mit verklärtem Blick.
War das schon immer so?
Also, wenn Du meine Mutter fragtest, würde sie dir sagen, dass ich schon mein ganzes Leben lang begeistert war, für eigentlich alles – oft für alles auf einmal. Blockflöte, Airbrush, Volleyball, Makramee, Badminton, Klettern …
Vieles davon hat sich in meinem Leben als Strohfeuer herausgestellt (deren ich kein einziges missen will). Anderes glüht warm, bis heute, zum Beispiel meine Liebe zur Musik, zum Basteln und natürlich zum Schreiben.
Jetzt da ich älter werde, stelle ich etwas Spannendes fest.
Es gibt bis heute Begeisterungsfelder, die ich ganz neu entdecke, erkunde und eine Zeit lang probiere. Manche schaffen den Sprung in die Liga meiner regelmäßigen Rituale und stabilen Lebensfreuden. Andere verabschieden sich wieder. Viele von ihnen hinterlassen schöne Erinnerungen und Spuren von „Ich weiß, wie das geht“.
Es gibt da aber noch etwas anderes.
Nämlich ein paar Feuer, ein paar Flammen, die schon lang in mir brennen, die aber erst im Rückblick einen konkreten Namen bekommen.
Das ist vielleicht ungefähr so wie bei einem Kind, das tanzt, seit es stehen kann, und dann mit fünf oder sechs zum ersten Mal eine Ballettaufführung sieht. Es spürt, es begreift: Ah, das ist es also, was ich schon die ganze Zeit mache. Das ist es, worum es meiner Seele eigentlich geht.
Worum es meiner Seele geht
Ich weiß noch, wann mich ein „Aha“ dieser Art zum ersten Mal erfasst hat. Das ist inzwischen mehr als zehn Jahre her. Damals habe ich ein Seminar besucht, das „Dialogprozessbegleitung“ hieß. Es ging da um eine Art von Gespräch, bei der man nicht diskutiert, nicht argumentiert, sondern bei der man von Herzen spricht und als Gruppe im Kreis in einen gemeinsamen kreativen Denkprozess kommt.
In diesem Seminar „lernte“ ich etwas, das ich eigentlich immer schon angestrebt hatte, in meiner Familie, in Gruppen, im Freundeskreis: keinen Smalltalk führen. Nicht zu schnell zu Ergebnissen kommen. Gefühle nicht wegreden, nicht lächerlich machen. Keine langen Monologe, aber auch kein Druck, alles schnell sagen zu müssen.
Immer schon hatte ich mich für Gesprächskultur, für Gefühle, für tiefere Ebenen der Betrachtung eingesetzt. Plötzlich bekam das alles einen Namen: „Dialogprozessbegleitung“. Hatte ich eh schon immer gemacht. Nun wusste ich also, wie es hieß. Ich machte es sogar zu meinem Beruf – viele Jahre lang leitete ich, glücklich und erfüllt, Lehrgänge und Seminare zu diesem Thema.
Mein zweites Aha
Das zweite große „So-heißt-das-also-Aha“ hatte ich vor etwa vier Jahren. Da schwappte ein Wort in mein Aufmerksamkeitsfeld, das es bisher leider nur auf englisch gibt. Ich wünschte, ich könnte es auf deutsch übersetzen.
Das Wort heißt: Memoirist.
Es bezeichnet Schriftsteller, die vor allem (oder ausschließlich) über ihr Leben schreiben – Geschichten, Essays, Memoirs, aber auch Tagebuchtexte. Ein zweiter englischer Begriff, der damit im Zusammenhang steht, ist der des „Life Writing“, er umfasst Tagebuchschreiben, Bloggen und das Schreiben autobiographischer Texte.
„I am a Memoirist“, kann man auf englisch sagen, um zu klären, dass man Schriftsteller*in ist, aber keine Romane schreibt.
Ja, genau, frohlockte ich damals: Ich bin also Memoirist – ich war es schon lange, aber erst seit damals kenne ich das passende Wort.
Es hat mir in meiner Arbeit zusätzlich Wert und Würde verliehen, vor allem vor mir selbst. Und auch die Menschen, die mit mir schreiben, freuen sich regelmäßig, wenn ich ihnen sage, wie das heißt, was sie sind. Ein Name gibt Kraft.
Was ich noch bin: mein drittes Aha.
Vor Kurzem nun hat ein drittes Feuer in mir seinen Namen bekommen. Seither will es gar nicht mehr aufhören zu lodern, und die Scheite, die es speisen, fliegen herbei, von überallher.
Bevor ich Dir den Namen des Feuers verrate (denkst Du auch gerade an Rumpelstilzchen, hihi?), tanze ich ein bisschen drumherum und erkläre Dir, worum es geht.
Ich arbeite ja seit vielen Jahren mit Menschen, die Bücher über ihr Leben schreiben – oder schreiben wollen. Sehr oft sind das Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben oder einen Schicksalsschlag durchstehen mussten. Andere Menschen, die zu mir kommen, möchten einfach ihre Erinnerungen wieder aufleben lassen, das Schöne in ihrem Leben festhalten und der Nachwelt etwas hinterlassen, das sie inspiriert oder verwurzelt.
Was sich dabei immer wieder zeigt: Ein Buch zu schreiben, bedeutet nicht, einfach alles (mit Betonung auf „alles“) in Worte zu fassen. Es bedeutet vorher, vor dem Losschreiben, etwas ganz anderes, Wichtiges. Nämlich: zu wählen.
Man kann nicht „alles“ erzählen.
Man würde nie fertig werden.
Und keiner würde es lesen wollen.
Unsere Leser wollen nicht „alles“.
Keine Leserin interessiert sich für das Chaos im Wohnzimmerschrank unseres Lebens, in dem alles irgendwie wichtig ist, vor allem für uns. Was Leser stattdessen wollen, ist eine gute, interessante Geschichte. Und diese zu finden und zu erzählen, ist unsere Aufgabe als Memoirists, also als Autor*innen von Lebensgeschichten.
(Kurze Anmerkung: Ja, auch wenn man viele kleine Geschichten aufschreibt, bleibt einem diese Suche nach der einen, eigentlichen Geschichte nicht ganz erspart. Aber das zu erklären, führt hier zu weit, das kommt ein andermal dran.)
Loslassen und wählen: das ist kein Honigklecken.
Auch für mich nicht.
„Es war so, das gehört doch dazu, das ist wichtig!“
So habe ich es meinem Lektor öfters erklärt, wenn ich in meinem Manuskript von „vier minus drei“ wieder einmal den Kommentar „streichen“ fand und meinte, protestieren zu müssen. „Für Sie vielleicht, aber nicht für die Geschichte“, hat mein Lektor dann immer gesagt. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich kapierte, dass sein Gefühl immer richtig war.
Inzwischen bin ich selber zur „Anwältin der guten Geschichte“ geworden. Wenn ich heute Manuskripte lese, vertraue ich meinem Instinkt und meiner Erfahrung, die mir beide zuraunen, wenn etwas von der eigentlichen Geschichte ablenkt, statt sie zu stärken.
Zusätzlich zu meinem Instinkt und meiner Erfahrung brauche ich aber natürlich noch etwas: nämlich Klarheit darüber, welche Geschichte eigentlich erzählt werden will.
Trommelwirbel … wir nähern uns einem entscheidenden Punkt.
„Ich hatte Brustkrebs und bin heute gesund.“
„Ich war psychisch krank und helfe heute Menschen mit Depressionen.“
„Ich bin Mutter von zwölf Kindern.“
„Ich habe drei Jahre auf einem Segelboot verbracht.“
„Ich pflege meiner Schwiegermutter, die Alzheimer hat.“
Sind das Geschichten?
Für die, die sich anschicken, sie aufzuschreiben, mag es sich erst einmal so anfühlen. Ich habe es erlebt, also muss es doch eine Geschichte sein, oder?
Die Wahrheit zeigt sich dann leider beim Schreiben – meistens so ab Seite 30 des Manuskripts: Da stockt es auf einmal. Die Erzählung verliert plötzlich an Fahrt. Man könnte so vieles schreiben, weiß aber gar nicht mehr, was. Alles wirkt seltsam langweilig, chaotisch, beliebig.
„Ist das spannend genug?“, fragen mich die Autorinnen dann, in der Hoffnung, doch ein „Ja“ zu bekommen. Leider muss ich meistens sagen: nein, ist es noch nicht. Aber nicht, weil Du nicht spannend schreibst, sondern weil Du noch nicht weißt, was genau Du erzählst.
Was ist das für eine Geschichte?
Wenn Du Dir verlegte biographische Bücher kaufst, steht der Inhalt der Geschichte schon am Buchcover, nämlich fast immer im Untertitel.
- Zum Beispiel bei meinem Buch „vier minus drei“: Wie ich nach dem Verlust meiner Familie zu einem neuen Leben fand. (Im Klappentext erfährt man dann auch noch, dass ich sehr jung war und als Clown arbeitete – all das ist Teil meiner Geschichte).
- oder beim Buch „Brüste umständehalber abzugeben“: Mein Leben zwischen Kindern, Karriere und Krebs (die Autorin ist Schlagfertigkeitstrainerin und versucht, ihrer Krankheit mit Humor zu begegnen. Steht nicht explizit da, aber es teilt sich schon mit und steht auch im Klappentext).
- oder beim Buch „Kühe kuscheln“: Wie die Tiere und ich ein neues Leben begannen. (Hier geht es nicht nur um Landleben, sondern um Umkehr, Neubeginn und das Finden von Lebensglück durch das Verlassen des urbanen Raums).
Nehmen wir ein eigenes Beispiel.
Hinter „Ich bin Mutter von zwölf Kindern“ könnten sich viele verschiedene Geschichten verbergen: ein erfülltes, naturnahes Leben abseits der Norm; das Leben in einer Sekte; das Leben einer alten Frau, die glücklich über ihre vielen Nachkommen ist (vielleicht hat sie 42 Enkel); das Leben einer Frau, die immer eine Tochter haben wollte, aber zwölf Jungen geboren hat; das Leben einer Geschäftsfrau, die Mutterschaft und Karriere auf magische Weise vereint; die Geschichte einer Frau, die elf Fehlgeburten hatte und dann endlich ein gesundes Kind bekam; die Geschichte einer Mutter von zwei Drillings- und drei Zwillingspaaren; die Geschichte einer Frau, deren Kinder nun alle auf eigene Kinder verzichtet haben und die sich fragt, warum das so ist …
Tolle Geschichten, nicht wahr?
Also, ich würde sie alle gern lesen.
Pass auf: Es geht sogar noch etwas genauer.
Betrachten wir probeweise die letzte Geschichten-Variante: eine Frau mit zwölf Kindern, die kein einziges Enkelkind hat. Welche verschiedenen Geschichten könnte sie uns erzählen?
Vielleicht die Geschichte einer Frau, die ihre Kinder verstehen will und sich damit auseinandersetzt, was die heutige Zeit von den 1970er Jahren unterscheidet. Oder die Geschichte einer Frau, die spät im Leben Freiheiten genießt, weil sie (endlich) keine Kinder mehr betreuen muss. Vielleicht auch die Geschichte einer Frau, die ihre Lebenserfahrung zwar nicht an eigene Enkel weitergeben kann, dafür aber nun ein Buch für die junge Generation schreibt, die ihr am Herzen liegt.
Es kann eine Geschichte des Haderns sein. Oder eine Geschichte des Glücks. Eine Geschichte der Weisheit. Eine Geschichte zweier Epochen. Eine Geschichte über Feminismus, eine Geschichte über die Kirche. Eine Geschichte der Enttäuschung, der offenen Fragen, oder eine Geschichte der Liebe. Eine Geschichte der späten Freiheit oder eine Geschichte der Demut für das, was Gott gibt (und nicht gibt).
Welche Geschichte erzählst Du?
Ich komme gleich (endlich) zum Punkt. Soll heißen: zu meinem Feuer und meiner Flamme.
Denn weißt Du: Als ich vor 12 Jahren begonnen habe, biographisches Schreiben zu unterrichten, dachte ich selbst noch, dass es reicht, gut schreiben zu lernen. Ich dachte, man kann alles erzählen, wenn man es nur gut erzählt.
In der Arbeit mit Autor*innen hat sich allerdings immer deutlicher gezeigt, wie wichtig vorab die Klärung ist: Welche Geschichte erzählst Du hier genau? Denn wenn das einmal klar ist, geht das Erzählen viel leichter –sogar einfache Sprache ohne literarische Kniffe überträgt dann das zu Sagende gut. Plötzlich ist alles klar, leicht und kraftvoll. Das Schreiben macht Sinn und hat eine Richtung.
Nebeneffekt: strahlende Augen.
Stell Dir vor, jemand kommt zu mir und sagt: Ich möchte ein Buch über meine Krebserkrankung schreiben. Wir arbeiten an der genauen Geschichte. Und plötzlich kann dieser Mensch sagen: Ich schreibe ein Buch darüber, wie ich durch meinen Krebs den Mut fand, mein Leben aufzuräumen und meine Träume zu leben. Spürst Du den Unterschied?
Oder jemand kommt und sagt: Ich pflege meine demente Schwiegermutter. Und es wird daraus: Ich schreibe ein Buch darüber, wie man einen Menschen, den man gar nicht mochte, ins Herz schließen kann und wie sich das insgesamt auf ein Leben und auf eine Familie auswirken kann, bis hin zu den Enkeln.
Kannst Du Dir vorstellen, wie da die Augen zu leuchten beginnen?
Jetzt kommt der Clou.
Die Frage nach der eigentlichen Geschichte kannst Du Dir nicht nur stellen, wenn Du ein Buch schreiben willst.
- Welche Geschichte erzählst Du Dir über Dich selbst?
- Magst Du sie?
- Kannst Du sicher sein, dass sie wahr ist?
- Gibt es Ausnahmen von dieser Geschichte?
- Welche Geschichte würde Dir besser (am besten) gefallen?
- Was würdest Du tun, wenn diese Geschichte wahr wäre?
Diese Fragen kannst Du auch auf Dein Leben anwenden. Auch, wenn Du nicht schreibst.
Und damit habe ich sie also endlich aus dem Sack gelassen, die liebe Katze. Denn die Fragen, die ich hier gerade aufgelistet habe, sind Fragen aus der sogenannten „narrativen Therapie“.
Dieses Wort ist das dritte große Aha meines Lebens: die Theorie zu dem, was ich seit vielen Jahren mache. Der Name für das, was mich seit so langer Zeit schon, namenlos, beschäftigt und begeistert.
Zur Orientierung:
Die narrative Therapie wurde in den 1980er Jahren von den Psychologen Michael White und David Epston entwickelt. Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Geschichten sich Menschen von sich selbst erzählen. Und damit, ob diese Geschichten brauchbar, hilfreich und wahr sind – und wie man diese Geschichten gegebenenfalls verändern oder modifizieren kann.
Ich bin keine narrative Therapeutin.
Aber alles, was ich derzeit über die narrative Therapie lese (und das ist viel), bestätigt die Erfahrungen, die ich als Memoir-Schreibcoach seit vielen Jahren mache:
1. Es gibt keine objektive biographische Wahrheit.
Wir sind immer das eine und auch das andere: Ängstlich – und auch mutig. Traurig – und auch dankbar. Zornig – und auch liebevoll. Chaotisch – und auch logisch. Suchend – und auch weise.
Je nachdem, durch welche Brille wir schauen: Wir werden immer „Beweise“ für alles in unserem Leben finden, wenn wir nur gewissenhaft suchen.
2. Geschichten sind magnetisch.
Wir erinnern immer an Ereignisse, die zu der Geschichte passen, die wir uns gerade über uns erzählen. Ja: Wir ziehen sogar im aktuellen Leben Ereignisse an, die zu dieser Geschichte passen. Wenn wir die Geschichte (das sogenannte „Narrativ“) verändern, erinnern wir uns plötzlich an ganz andere Dinge – und das Leben im Jetzt verändert sich auch.
3. Wir übernehmen Geschichten – aber wir haben die Wahl.
Negative Geschichten über uns selbst sind uns oft eingeimpft worden – von Eltern, von Lehrern, von der Gesellschaft oder von Menschen, die im falschen Moment etwas sagten, das sich einbrannte. Es braucht manchmal nur einen Stups, ein paar kleine Gegenbeweise, und schon bricht eine andere, bessere Geschichte aus uns hervor.
4. Unser Selbst(wert)gefühl nährt sich von den Geschichten, die wir erzählen.
Wenn ich mich an Situationen erinnere, die mich glücklich gemacht haben oder auf die ich stolz bin, fühle ich mich gleich wieder stark und froh. Wenn ich darüber schreibe, wie ich mich mutig für etwas eingesetzt habe, spüre ich die Kraft wieder in mir. Wer etwas aus der Haltung der Liebe schreibt, kommt in Verbindung mit seiner Liebesfähigkeit. Wer etwas aus der Haltung der Erfahrung und Weisheit schreibt, fühlt sich gleich nicht mehr klein und verzagt.
In der Poesietherapie nennen wir das „ressourcenorientiert“: Wir verbinden uns mit dem Guten in unserem Leben und geben ihm Raum am Papier, im Herz und im Erzählen. Das Schlechte wird dadurch nicht ungeschehen, aber es bekommt ein gutes Gegengewicht. Oft zeigt sich dann, dass das Schlechte gar nicht so groß und so dominant ist, wie wir dachten.
5. Neue (alternative) Geschichten verstecken sich oft in Kleinigkeiten.
In der narrativen Therapie nennt man das die „Suche nach Ausnahmen“: Ein ängstlicher Mensch sucht da nach kleinen Momenten, in denen er ein klein bisschen mutig war. Ein depressiver Mensch wird aufgefordert, zu erzählen, wie er es gestern kurz auf die Straße geschafft hat.
Im biographischen Schreiben suchen wir nach kleinen lebendigen Szenen, nach Erinnerungen, die uns zum Lächeln bringen, nach vielsagenden Details und nach konkreten Situationen. „Wie war das genau?“, diese Frage ist unglaublich fruchtbar und führt oft zu Geschichten, die die Starre in einem Narrativ aufbrechen.
Als Beispiel: ein Buch über Trauer. Was passiert, wenn man glückliche Erinnerungen aufschreibt? Wenn man davon erzählt, wie das Begräbnis genau abgelaufen ist – inklusive der schönen Musik, der Umarmungen, der liebevollen Rede am Grab? Wenn man erzählt, was man genau gemacht hat, als man nach dem Begräbnis nach Hause gekommen ist? Hier finden sich oft kleine Zeichen der Selbstfürsorge, der Dankbarkeit, der Geborgenheit, der Zugehörigkeit, des Mutes, der Lebensbejahung.
6. Wir sind mehr als nur eine Geschichte.
Es gibt gewisse Umstände oder Ereignisse im Leben, die sich sehr wichtig machen und behaupten: Ich bin Deine Geschichte. Davon kann ich als „die Frau, die ihre Familie verloren hat“ mehr als ein Liedchen singen. In einem tollen TED-Talk spricht die Nigerianische Autorin Chimananda Adichie von „The Danger of a Single Story“, also von der Gefahr, die besteht, wenn wir uns oder andere Menschen auf eine einzige Geschichte reduzieren.
In meinem Memoir-Kurs „Dein Leben als Buch“ fordere ich meine Teilnehmer*innen zu Beginn bewusst auf, scheinbar nebensächliche Kleinigkeiten aus ihrem Leben zu erzählen, etwa eine Geschichte über ein Kleidungs- oder Schmuckstück, eine Geschichte über die Schlafzimmer ihres Lebens oder über das, was vor ihrer Nase ist. Es ist schon ein paar Mal passiert, dass jemand, der anfangs ein Buch über eine Schicksalsgeschichte schreiben wollte, plötzlich umgeschwenkt ist und stattdessen über die Freuden seines Lebens oder über liebe Wegbegleiter schrieb.
Das Feuer brennt weiter, die Flamme bleibt hell.
Ich werde die narrative Therapie nicht zu meinem neuen Beruf machen. (Mama, keine Sorge, ich habe schon oft genug den Beruf gewechselt, ich bin froh mit dem, was ich mache 😊 ) Aber das, was ich über die narrative Therapie lerne, fließt schon jetzt – und sicher immer mehr – in meine Arbeit als Schreibpädagogin ein.
Denn ich weiß schon lange, wie wichtig die Fragen sind, die wir uns vor dem Losschreiben stellen. Ich weiß, wie gut es tut, sich die richtigen Geschichten über das eigene Leben zu erzählen. Ich weiß um meine Verantwortung, gute Schreibimpulse zu geben, die Ressourcen aktivieren. Und ich weiß, wie viel sich im Leben von Menschen verändern kann, wenn sie sich die Version ihrer Geschichte aussuchen, die ihnen am besten gefällt, und sie durch Szenen, Details, Buchkapitel, durch ein Buchcover und Klappentexte untermauern.
Ich bin dankbar für alles, was das Schreiben in diesem Sinne bewirkt, bei mir und bei den Menschen, die mit mir schreiben.
In diesem Sinne: gutes Los- und Weiterschreiben,
Deine Barbara Pachl-Eberhart
P.S.: Wenn Du nach einem ganz einfachen Weg suchst, die Magie von selbst geschriebenen Geschichten anzuzapfen, findest Du hier meine magische Geschichtenformel mit Glücks- und Stolzgarantie. Einfach herunterladen, losschreiben und Dein Leben vielleicht schon in einer halben Stunde mit ganz neuen Augen sehen. Viel Spaß!
Schreibe einen Kommentar
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

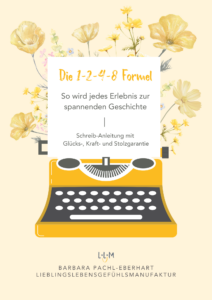

Eine Antwort
Heihei liebe Barbara,
zu deiner Frage im Newsletter Innen Hui – Aussen Wui und der Frage: Hast Du ein Ziel, bei dessen Verwirklichung Dir das Schreiben hilft?
Mein Ziel in einem Wort:
Lebensrhythmus (entdecken und ehren)
Kernbotschaft in drei Sätzen:
Schreiben führt mich zurück zu meinem eigenen Takt des Lebens — jenseits fremder Erwartungen, in Verbindung mit meinen Werten und meiner Wahrheit. Es verwandelt innere Schwere in Klarheit und Lebendigkeit, die trägt und nährt. Worte werden Brücken, um Perspektiven zu öffnen, Vielfalt zu beleuchten und Menschen zu umarmen, ohne sie festzuhalten.
PS: und danke für deinen augenwässernden Text. Erinnert mich sehr an meine Lebensgeschichte: oder dem Bild, das Pferd gerne von hinten aufzäumen oder einfach mal ohne Sattel reiten. Danke dafür
Ellen grüßt👋🏻